Der langsame Tod der Gasthäuser
Ein Beitrag von Philipp Martin
Wer als Liebhaber uriger badischer Küche durch die vielen Dörfer im Kraichgau fährt, bekommt unweigerlich feuchte Augen. In fast jedem Ort führt ihn der Weg vorbei an geschlossenen Gasthäusern. Die goldenen Zeiten der Kronen, Löwen, Ochsen, Schwanen und der grünen Bäume sind längst vergangen und das nicht erst seit Corona. Nur noch verblasste Schilder und rostige Galionsfiguren erinnern an jene Tage als das Bier aus dem Zapfhahn sprudelte und das Hämmern der Schnitzelklopfer aus der Küche schallte. Schon längst hat die Ära der Lieferdienste, der „Geiz ist Geil“-Mentalität und des sozialen Rückzuges Einzug gehalten und die traditionelle Dorfgaststätte zur bedrohten Art werden lassen.

In meiner Kindheit war es an jedem Sonntag Tradition gemeinsam Essen zu gehen. Ziel war in Eppingen meist das „Eiserne Kreuz“ wo die Wirts-Oma die besten Zwiebelrostbraten und noch bessere Schäufele auf den Tisch zauberte. Wir Kinder tobten durch den Raum, vorbei an Skat-spielenden Opas, dem schweigsamen Zocker am Daddel-Automaten, dem Radler-Trupp (damals noch ohne die lächerliche Kostümierung) und den Stiefel-kippenden Spielern des VFB Soundso. Niemand störte es, jeder war willkommen. Heute gibt es das „Eiserne Kreuz“ nicht mehr.
Das Wirtshaus war der Dorfmittelpunkt
Ja, damals waren die Wirtshäuser noch echte soziale Hot Spots. Bei einem Viertele am Stammtisch konnte man damals an einem Abend mehr erfahren als hier auf hügelhelden.de in einem Monat (wenn auch nur 10% davon gestimmt haben dürften). Wieso gerade die Straße vor dem Haus des Bürgermeisters saniert wurde, mit wem die Frau vom Metzger Heinz rumturtelt und natürlich viel Gebruddel über die Regierung Kohl und die Idioten in Bonn.
Es war zwar unglaublich viel blödes Geschwätz dabei, aber zumindest haben sich echte Menschen im echten Leben getroffen und über echte Angelegenheiten gesprochen anstatt ihren Gehirn-Dung nur im Netz zu verteilen. Heute haben vor allem die Älteren das Nachsehen. Viele bleiben zu Hause und vereinsamen dort, wartend auf einen gnädigen frühen Tod. Die Jungen ziehen sich ins Internet zurück und chatten, skypen, twittern und facebooken (nennt man den Scheiß so?) Doch auch Sie sehnen sich nach mehr handfesten Kontakten. Wie sonst kann man sich das Abhängen an öden Bushaltestellen erklären, die in ansonst toten Orten zum deprimierenden Notnagel für die Kids wurden.

In Bayern heißt es ganz trotzig: Stirbt das Wirtshaus, stirbt der Ort. Nicht nur eine gute Verkehrsanbindung und ein geregelte Nahversorgung sind wichtig – Nein, es braucht einfach auch ein paar urige Kneipen. Seit Anbeginn der Zeit sind die Menschen in Spelunken, Tavernen, Kaschemmen, Trinkhallen und Gluckerstuben gepilgert. Nicht weil das Bier dort besser war als Zuhause, sondern weil es gemeinsam gekippt einfach besser schmeckt. Es geht nicht um das Bier, sonder um das „Wir“ – verdammt, ich bin ein Poet!
Die Renaissance steht vor der Tür
Seit Anfang der 90er ist der Bestand an Gaststätten im Land um mehr als die Hälfte zurück gegangen und sogar die verbleibende Hälfte soll sich kurz oder lang noch einmal halbieren. Ein trostloses Bild, wenn auch viele ausländische Wirte tapfer versuchen die Lücken zu schließen. Doch in einer Dönerbude gemeinsam ein Bier zu trinken während der Hackspieß seine Runden zieht, das türkische Fernsehen Seifenopern zeigt und die obligatorische barfüßige Frau aus Ihrem Bild, Teigfladen rollend auf mich herabblickt – das ist einfach nicht meine Welt. Versteht mich nicht falsch, es geht nichts über einen guten Yufka und einen netten Schwatz mit mit meinen liebenswerten Stamm-Döner-Dealern – doch von der Aufmachung her sind Dönerbuden eben keine Orte, an denen man lange gesellige Abende verbringt.
Es gibt zwar noch einige Landgasthöfe die es geschafft haben und mit viel Know-How aus der Systemgastronomie an den Wochenenden ihren Umsatz wuppen, doch auch Sie müssen stetig kämpfen. Die Familienbetriebe kapitulieren spätestens dann, wenn die Jungen den Laden nicht mehr übernehmen wollen. Dank gefühlt tausenden EU-Regelungen und immer weiter steigender Kosten, kann Ihnen das auch kaum jemand verdenken. Schließlich wäre dann da noch Captain Covid, der vielen Traditionsbetrieben durch die monatelangen, zwangsweisen Schließungen den Rest geben wird.

Doch es gibt auch einen kleinen Silberstreif am Horizont. Umfragen zeigen dass die jüngere Generation wieder ihre Sehnsucht nach dem Einfachen und Ursprünglichen entdeckt. Es muss nicht mehr ums Verrecken die hippe Großstadt-Bar mit Mondpreisen für Trendgetränke sein. Viele zieht es auch wieder in Richtung des Traditionellen. Diese große Welt ist so dermaßen unüberschaubar, so hektisch und durch den Dauerbeschuss aus den Medien auch einschüchternd und ernüchternd geworden, dass im Einfach wieder ein Anker gesehen wird. Lieber lokal als global – dieses Credo reift derzeit in vielen jungen Köpfen heran. Für viele Wirte im Kraichgau kommt dieser Trend leider zu spät. Das letzte Bier wurde schon längst gezapft, die Stühle schon lange hochgesteckt. Doch vielleicht wächst irgendwann eine neue Generation junger Wirte heran, die die Kronen wieder aufpolieren, Löwe, Lamm und Ochse wieder füttern und die Linden, Eichen und grüne Bäume mit frischem Wasser gießen. Ich würde es mir sehr wünschen.


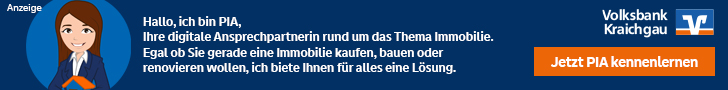




Lieber Herr Martin, so schlecht war sie nicht die gute alte Zeit. Und das Garthaus Zum Bahnhof in Gochsheim kenne ich seit meinen Kindertagen. Nebenan gab es eine Metzgerei mit ausgezeichneten Fleisch- und Wurstwaren. Nun hat eine junge Frau mit großem finanziellen Aufwand das Gebäude erhalten, welches der scheidende Bürgermeister einer „Kunststadt“ gerne hätte abreissen lassen wollen. Da bedarf es eben manchmal willenstarken Menschen, sonst wäre im Städtchen Gochsheim ein markantes Gebäude weniger. Vielen Dank für Ihre Meinung.